Der Diabetische Fuß – Teil 3: Die Wundversorgung – Debridement, feuchte Wundtherapie und moderne Verbandsmaterialien
Am Anfang jeder konkreten Behandlung eines diabetischen Fußulkus steht die Lokaltherapie der Wunde selbst. Hier haben sich in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte ergeben – weg von der veralteten „Trockenlassen“-Methode hin zu modernen, standardisierten Wundversorgungsstrategien. Dieser Artikel gibt Ihnen einen Überblick über die Methoden der Wundversorgung beim Diabetischen Fußsyndrom, häufig verwendete Materialien und den wichtigen Schritt zu Beginn: das Debridement.
Debridement (Wundreinigung) beim diabetischen Fuß
Ein chronisches Ulkus heilt nur auf einer sauberen, gut durchbluteten Wundfläche. Nekrosen (abgestorbenes, schwarzes Gewebe) und gelblicher Fibrinbelag behindern die Heilung und bieten Bakterien einen Nährboden. Deshalb muss eine DFS-Wunde in der Regel regelmäßig gereinigt werden.
Das Standard-Debridement erfolgt mechanisch mit einer sterilen Mullkompresse und einer ausreichenden Nassphase, ein scharfes oder sogar chirurgisches Debridement, meist mit sterilem scharfen Löffel, einer Cürette oder einem Skalpell durch geschultes Personal (Arzt).
Abgestorbenes Gewebe wird dabei schichtweise abgetragen, bis gut durchblutetes Gewebe („punktförmiges Bluten“) sichtbar wird. Auch Hornhautränder am Ulkus werden abgetragen, da sie den Druck erhöhen und eine Barriere für das Epithelwachstum bilden.
Dieses Vorgehen mag drastisch klingen, ist aber vor allem aus diesem Grund wichtig: Konsequentes Debridement verbessert die Heilungsraten drastisch.
Bei Bedarf (und wenn der Patient Schmerzen spürt) kann dies auch in Lokalanästhesie geschehen. In schweren Fällen, etwa bei gangränösem Gewebe, kann ein chirurgisches Debridement im OP erforderlich sein.
Sonderformen des Debridements
Neben dem mechanischen Debridement gibt es auch das sogenannte biochirurgische Debridement. Dabei werden sterile Fliegenmaden eingesetzt, die nekrotisches Gewebe auffressen. In Deutschland wird das gelegentlich bei schlecht abgrenzbaren Nekrosen eingesetzt, wenn chirurgisch nicht alles entfernt werden kann oder soll.
Auch hydrochirurgische Verfahren sind verfügbar, bei denen ein hochpräziser Wasserstrahl oder Ultraschall genutzt wird, um nekrotisches oder infiziertes Gewebe am diabetischen Fuß schonend und selektiv zu entfernen. Diese minimal-invasive Methode schont umliegendes, gesundes Gewebe, reduziert Traumata und fördert durch die präzise Wundreinigung eine effektivere Wundheilung bei den oft komplizierten Wunden des diabetischen Fußes.
Wichtig bei jedem Verfahren: Nach dem Debridement sollte die Wunde erneut beurteilt und die Klassifikation ggf. angepasst werden.
Infektionskontrolle beim diabetischen Fuß
Parallel zur lokalen Säuberung muss immer der Infektionsstatus bedacht werden. Zeigt die Wunde Anzeichen einer Infektion, wird je nach Ausmaß antibiotisch behandelt, da hier das Amputationsrisiko erhöht ist. Oberflächliche, lokale Infektionen können manchmal aber auch schon durch das konsequente Debridement und antiseptische Wundauflagen beherrscht werden.
Bei deutlich infizierten Wunden (ab einer Umgebungsrötung von bereits 5cm mit starkem Geruch, Rötung und Überwärmung) ist jedoch eine systemische Antibiotikatherapie notwendig, idealerweise nach Abstrich (Beachtung der Abstrichart) und Erregerbestimmung.

Die Antibiotika-Auswahl richtet sich nach dem Keimspektrum (häufig sind Staphylokokken, Streptokokken, aber auch gramnegative Bakterien beteiligt; bei chronischen Wunden mit Antibiotikavorbehandlung oft multiresistente Keime).
Bei einer Infektion darf auf keinen Fall „abgewartet“ werden – eine sich ausbreitende Infektion kann in Stunden oder Tagen zur ausgedehnten Phlegmone oder Sepsis werden. Dann muss eventuell notfallmäßig operiert werden, um das infizierte Gewebe zu entfernen.
Daher gilt: Im Zweifelsfall frühzeitige chirurgische Intervention und antibiotische Abdeckung.
Feuchte Wundbehandlung beim diabetischen Fuß
Nachdem die Wunde sauber ist (oder so sauber wie möglich gemacht wurde), wird sie mit einem geeigneten Verband versorgt.
Es hat sich endgültig durchgesetzt, dass ein feuchtes Wundmilieu die Heilung fördert. In einer feuchten, „geschützten“ Umgebung können neue Hautzellen und Blutgefäße viel schneller einwachsen als in einer ausgetrockneten Wunde mit Schorf.
Das belegt bereits die klassische Studie von Winter (1962) und wurde seither durch viele Untersuchungen bestätigt.
Vorteile der feuchten Wundtherapie sind:
- Schnellere Heilung
- Weniger Narbenbildung
- Geringeres Infektionsrisiko, da Immunzellen im feuchten Milieu aktiver sind
Achtung: Trockene Nekrosen bei unbekannten Gefäßstatus bleiben zunächst immer im trockenen Zustand und benötigen in der Regel beim fehlenden Exsudat auch keinen Wundverband. Hier zählen vor allem absolute konsequente Druckentlastung, Gefäßstatuserhebung und danach die chirurgische Sanierung.
Verbände für den diabetischen Fuß
Heute stehen zahlreiche moderne Wundauflagen zur Verfügung, um ein ideales Feuchtigkeitsniveau zu erhalten. Diese hydroaktiven Verbandmaterialien können je nach Bedarf Feuchtigkeit spenden oder überschüssiges Wundexsudat aufnehmen, um weder Austrocknung noch Aufweichung zuzulassen.
Zu den gängigen Verbandstypen gehören z. B.:
- Alginate und Hydrofaser: Verbände aus Algenmaterial oder speziellen Polymeren, die bei Kontakt mit Wundexsudat aufquellen und ein Gel bilden. Sie eignen sich für stark exsudierende (nässende) Wunden, da sie viel Flüssigkeit aufnehmen können. Dabei halten sie die Wunde trotzdem feucht, weil das Gel nicht austrocknet. Diese werden bei jedem Verbandswechsel erneuert.
- Schaumverbände: Weiche, schwammartige Polymerschäume, die ebenfalls Flüssigkeit aufnehmen, aber auch schützend wirken. Sie werden in der DFS-Therapie eingesetzt.
- Antimikrobielle Wundauflagen: Bei infizierten oder infektgefährdeten Wunden werden oft spezielle Verbände mit antibakterieller Wirkung eingesetzt. Bekannt sind Silberauflagen (Schäume, Alginat oder Vliese mit Silberionen, die gegen ein breites Keimspektrum wirken) oder Polyhexanid-Biguanid (PHMB)-getränkte Verbände. Auch Honig-basierte Auflagen (Medizinalhonig wie Manuka) wirken antibakteriell und entzündungshemmend.
Wichtig: Diese ersetzen nicht die antibiotische Therapie, können aber lokal die Keimlast senken. - Verbände mit Wachstumfaktoren oder Kollagen: In speziellen Fällen werden auch Produkte eingesetzt, die z. B. Kollagen enthalten (um der Wunde eine Matrix zum Zellwachstum zu bieten) oder wachstumsfördernde Substanzen. Ein Beispiel ist ein Gel mit PDGF (Platelet Derived Growth Factor), das in Einzelfällen die Heilung fördern kann – in Deutschland ist das jedoch weniger etabliert.
Bei der Auswahl des Verbandes gilt es, Phase und Zustand der Wunde zu berücksichtigen. Ist viel Wundexsudat da (exsudative Phase)? Gibt es noch Beläge? Oder beginnt schon die Granulation (Bildung von rotem, körnigem Granulationsgewebe)? Entsprechend spricht man vom phasengerechten Wundmanagement.
Wichtig ist auch die atraumatische Handhabung: Verbände sollten sich entfernen lassen, ohne das neu gebildete Gewebe zu zerstören. Hierfür sind moderne Produkte oft mit speziellen Silikonrändern ausgestattet, die nicht mit der Wunde verkleben.
Wundversorgung beim diabetischen Fuß: Verlaufskontrolle und Anpassung
Abschließend gehören zur Standardtherapie natürlich auch immer die Druckentlastung und die systemische Komponente (Blutzucker-Einstellung, Antibiotika etc.). Das beste Verbandsmaterial nützt wenig, wenn der Patient weiter auf der Wunde herumläuft, oder wenn die ursächliche PAVK unbehandelt bleibt.
Außerdem extrem wichtig: die Verlaufskontrolle und Dokumentation. Dabei wird jede Veränderung der Wunde dokumentiert, oft fotografisch, um den Heilungsverlauf zu beobachten.
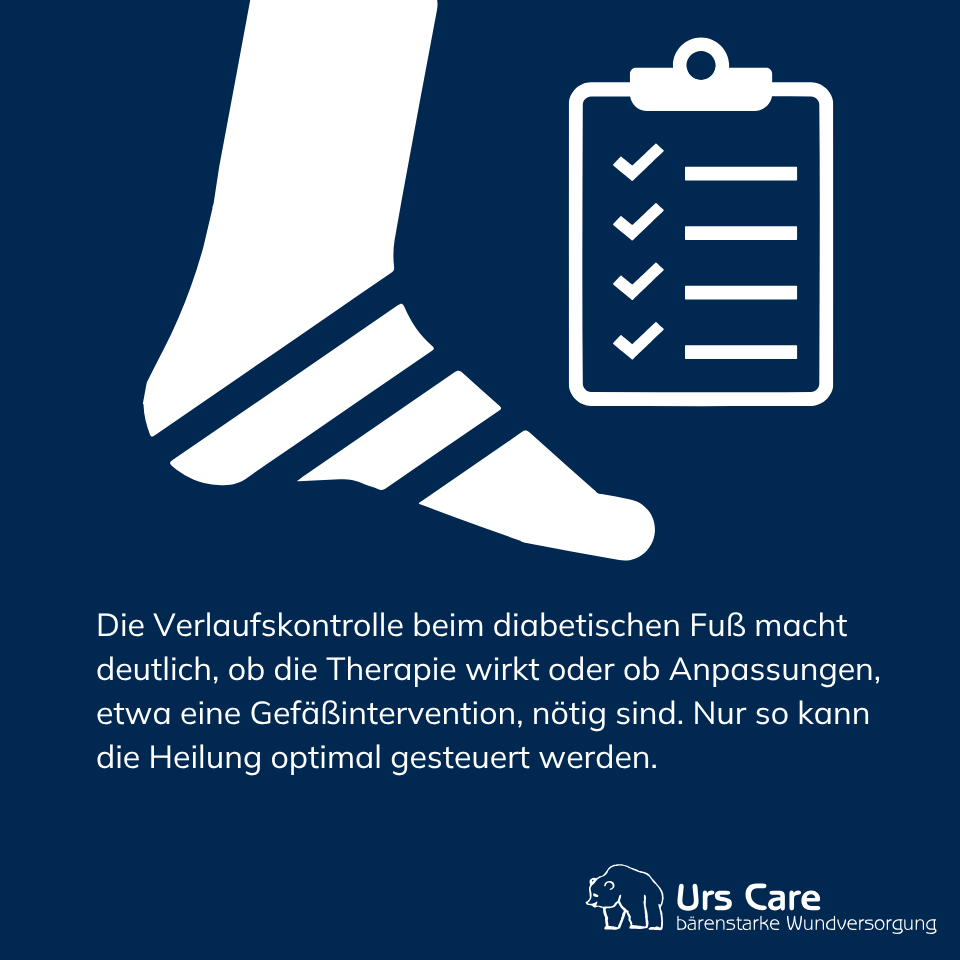
Verbessert sich ein Ulkus trotz adäquater Therapie innerhalb von zwei bis vier Wochen nicht, muss das Konzept überdacht werden – beispielsweise muss vielleicht doch eine Gefäßintervention durchgeführt oder ein anderes Verbandmaterial versucht werden.
Neue und herkömmliche Therapieansätze in der Wundversorgung beim diabetischen Fuß Hautersatz, Wachstumsfaktoren, Druckentlastung und Unterdrucktherapie
Trotz aller Standardmaßnahmen heilen manche Wunden nur sehr langsam oder gar nicht. In solchen Fällen – oder um die Heilung generell zu beschleunigen – kommen neue Therapieansätze ins Spiel. Einige davon klingen wie Science-Fiction, andere haben bereits Eingang in die Versorgung gefunden.
Hier ein Überblick über innovative Methoden und deren Stellenwert:
Bioengineered Skin (Künstlicher Hautersatz)
Dabei handelt es sich um im Labor gezüchtetes Haut- oder Gewebematerial, das auf die Wunde aufgelegt wird, um die Heilung anzustoßen. Beispiele sind Produkte aus körpereigenen Zellen (autologe Hautstücke, aus Patienten-Hautzellen gezüchtet) oder heterologe Transplantate aus menschlichen Hautzellen (Fibroblasten/Keratinocyten) auf einer Kollagenmatrix.
Auch aus tierischen Quellen, z. B. Amnion/Chorion-Membranen (Plazenta-Haut) oder aus Schweinedarm gewonnene Membranen wurden getestet. Diese Hautersatzprodukte liefern Wachstumsfaktoren, eine Matrix für Zellmigration und decken die Wunde ab.
Wachstumsfaktoren und Stammzelltherapie
Schon seit längerem wird versucht, durch applizierte Wachstumsfaktoren die Heilung anzukurbeln. Neuere Ansätze untersuchen VEGF (vascular endothelial growth factor) oder andere Faktoren, teils in Kombination mit Trägern, um lokal neue Gefäße sprießen zu lassen.
Eine andere Schiene ist die Stammzelltherapie. Dabei sollen patienteneigene oder Spender-Stammzellen in die Wunde oder in die Blutbahn gebracht werden, um die Durchblutung zu verbessern und die Heilung zu fördern. Diese Verfahren sind jedoch noch experimentell; ob und wann sie zur Routine werden, ist offen.
Druckentlastung (Offloading)
Kein Fußulkus wird heilen, wenn ständig Druck darauf lastet. Besonders Plantarulzera (an der Fußsohle) können nur abheilen, wenn der Patient möglichst nicht auf die Wunde tritt.
Der Goldstandard dafür ist der Total Contact Cast (TCC) – ein spezieller Gipsverband, der so angepasst ist, dass er den Druck gleichmäßig verteilt und den Patienten am Abrollen hindert. Studien zeigen, dass TCC exzellente Heilungsraten hat. Allerdings ist ein Gips unflexibel.
In Deutschland werden daher häufiger abnehmbare Entlastungs-Orthesen genutzt: etwa Aircast-Schienen, spezielle Stiefel („Walker“), die den Fuß immobilisieren, je nach Ulkus-Lokalisation.
Wichtig ist, dass die Patienten diese Hilfsmittel konsequent tragen. Jede Ausnahme – „nur schnell ohne Schuh zur Tür“ – kann die fragile, neugebildete Gewebeschicht wieder zerstören.
Unterdruck-Wundtherapie (Negative Pressure Wound Therapy, NPWT)
Hierbei wird ein Schwamm in die Wunde eingelegt und mittels einer Vakuumpumpe ein Unterdruck angelegt, sodass kontinuierlich Wundflüssigkeit abgesaugt wird und die Wundränder zusammengezogen werden. Umgangssprachlich ist oft vom „VAC-Verband“ die Rede (Vacuum Assisted Closure).
Beim diabetischen Fuß wird NPWT z.B. nach einem umfangreichen Debridement eingesetzt, um die Wunde zu verkleinern und sauber zu halten, bis eventuell eine Hauttransplantation erfolgen kann.
Wichtig: NPWT muss immer von einem Arzt begleitet und überwacht werden.
Hyperbare Sauerstofftherapie (HBOT)
Patienten atmen dabei in einer Druckkammer 100 %igen Sauerstoff, wodurch mehr O₂ im Blut gelöst und theoretisch schlecht durchblutetes Gewebe besser versorgt wird. Allerdings ist der Aufwand hoch (viele Sitzungen in Druckkammer) und nicht überall verfügbar. Es bleibt meist eine Zusatzmaßnahme in spezialisierten Zentren.
Kaltplasma und topische Sauerstofftherapie
Neuere lokale Therapien sind z.B. kaltes Plasma – ionisiertes Gas, das auf die Wunde gerichtet wird und Keime abtöten sowie die Heilung stimulieren soll – oder die lokale Sauerstoffinsufflation, bei der die Wunde in einer Kammer mit Sauerstoff umspült wird. Beide Methoden werden in Studien erprobt. Stand 2024 sind sie experimentell.
Fibrin-/Thrombozyten-Patches
Autologe Thrombozytenkonzentrate (z. B. PRP – Platelet Rich Plasma) können zu einem Gel oder Patch verarbeitet und auf die Wunde gebracht werden. Diese enthalten patienteneigene Wachstumsfaktoren in hoher Konzentration.
Allerdings muss man auch hier sagen: Die Studienlage ist dünn; manche Hypes erwiesen sich als überzogen. Die Krankenkassen-Erstattung solcher Verfahren ist derzeit nicht geklärt, was ihre breite Anwendung hemmt.
„Fischhaut“-Wundabdeckung
Klingt ungewöhnlich, wird aber erprobt: Ein Produkt aus der Haut von Fischen (z.B. Kabeljau) wird auf die Wunde gelegt. Diese Fischhaut ist decellularisiert und reich an Omega-3-Fettsäuren, die anti-inflammatorisch wirken sollen.
Zusammengefasst lässt sich sagen: Neue Therapieansätze bieten Hoffnung für schwierige Fälle, doch sie ersetzen nicht die Basismaßnahmen. Oft sind sie teuer und nur in speziellen Zentren verfügbar.
Die meisten Leitlinien empfehlen, innovative Methoden erst nach Ausschöpfen der Standardtherapie einzusetzen und möglichst im Rahmen von Studien. Dennoch ist es wichtig, die Entwicklung zu verfolgen: Was heute experimentell ist, kann morgen Standard sein.
Beispielhaft sei erwähnt, dass vor wenigen Jahrzehnten Unterdrucktherapie und Wachstumsfaktoren noch Neuland waren – heute gehören sie vielerorts zum Repertoire.
Für die Patienten bedeutet das: Wenn eine Wunde trotz aller Routine-Maßnahmen nicht heilt, lohnt es sich, nach spezialisierten Zentren zu fragen, die neue Verfahren anbieten.
Telemedizinische Zweitmeinungsportale oder Netzwerke können hierbei helfen. So gibt es Modellprojekte, die Telemedizin einsetzen, um Landpraxen mit Wundzentren zu vernetzen. Der behandelte Arzt kann dann via Telekonsil Rat einholen, ob z. B. ein künstlicher Hautersatz oder eine bestimmte Studie verfügbar ist.
Wichtig ist aber auch eine nüchterne Sicht. Solange wissenschaftliche Beweise fehlen, sollte man falsche Hoffnungen vermeiden. Im Mittelpunkt steht nach wie vor das konsequente Umsetzen der bewährten Grundlagen.

